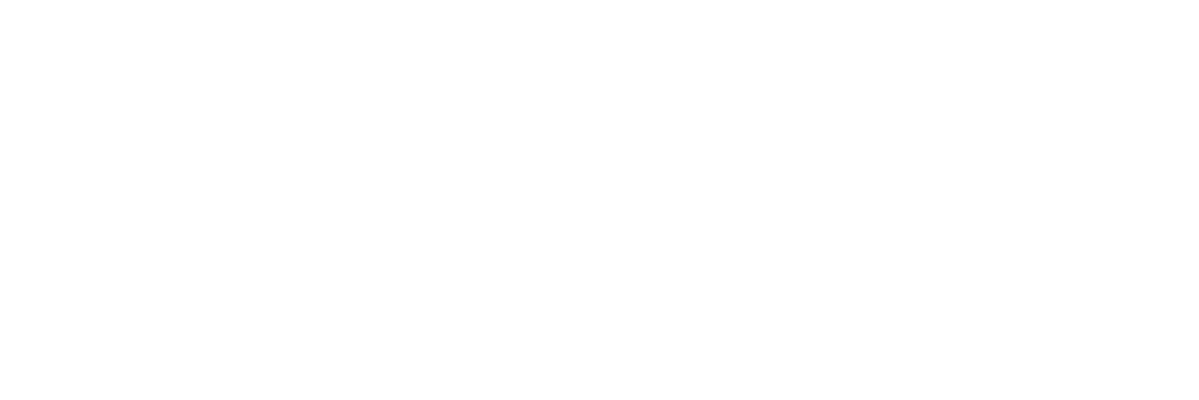Dass jemand sich selbst beim Singen nicht hört oder die Töne nicht trifft, ist in der Gesangspraxis kein Randphänomen – sondern ein häufiges, vielschichtiges Thema. Dabei ist nicht nur das „Ohr“ gefragt, sondern ein ganzes Zusammenspiel von Wahrnehmung, innerer Vorstellung, motorischer Kontrolle und Selbstbewusstsein.
Hier sind die häufigsten Ursachen – und wie man sie verstehen kann:
1. Ungeübte Tonhöhenwahrnehmung
Viele Menschen sind es im Alltag nicht gewohnt, sich mit Tonhöhen auseinanderzusetzen.
Ob jemand zu hoch, zu tief oder richtig singt, ist keine Selbstverständlichkeit – es muss gelernt werden. Am besten schon im Kleinkindalter! Unser Lebensalltag jedenfalls fordert diese Fähigkeit nicht von uns. Deswegen müssen wir uns ihr bewusst widmen, wenn wir singen lernen wollen.
Bei ungeübter Tonhöhenwahrnehmung fehlt oft die Fähigkeit, Töne genau zu unterscheiden (z. B. ein A von einem H), oder sie bewusst nachzusingen.
Häufig hört man:
„Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin.“
„Ich dachte, ich hätte den Ton getroffen – aber er war daneben.“
Das ist kein Zeichen von „Unmusikalität“, sondern schlicht ein Mangel an innerer Referenz: Das Gehör hat keine präzise „Landkarte“, auf der es sich orientieren kann.
2. Keine klare Vorstellung vom Ton
Bevor man einen Ton singen kann, muss man ihn sich innerlich vorstellen – wie beim inneren Lesen einer Melodie.
Dieser mentale Schritt fehlt bei vielen ungeübten Sänger:innen. Sie hören zwar einen Ton, aber er „bleibt nicht hängen“, kann nicht innerlich reproduziert werden.
Typische Folge: Die Stimme schießt daneben, weil sie ins Leere zielt.
Die innere Vorstellungskraft muss erst aufgebaut werden – durch bewusstes Hören, Summen, Mitsingen und Nachfühlen.
3. Störung der Selbstwahrnehmung
In Chören oder Gruppen geht die eigene Stimme schnell unter – vor allem, wenn sie noch leise, vorsichtig oder undeutlich geführt wird. Viele hören beim Singen hauptsächlich die anderen – und verlieren dabei sich selbst.
Besonders problematisch ist das für Menschen, die nie gelernt haben, ihre Stimme gezielt gegen eine Umgebung zu behaupten oder differenziert herauszuhören.
Auch Raumakustik und Position spielen hier eine Rolle – z. B. wenn jemand zwischen zwei kräftigen Sänger:innen sitzt.
4. Fehlendes Körpergefühl für Tonhöhe
Gutes Singen hängt nicht nur vom Ohr ab, sondern auch vom Körper. Der Ton wird im Körper erzeugt – und man kann (und sollte) ihn spüren: in der Brust, im Gesicht, im Kopf, über die Knochenleitung. Viele Menschen singen aber „vom Hals weg“ – ohne Resonanz, ohne Verbindung zum Körper.
Wer die Stimme nicht im Körper erlebt, verliert sich leicht – sowohl in der Tonhöhe als auch im Ausdruck.
Summübungen, Brummklänge, Selbstwahrnehmung über Berührung (z. B. Kehlkopf, Brustbein) helfen, dieses Körpergefühl aufzubauen.
5. Hörprobleme – neurologisch oder altersbedingt
In seltenen Fällen liegt eine sogenannte Amusie vor – eine angeborene oder erworbene Schwäche, Tonhöhen zu erkennen oder sinnvoll zuzuordnen.
Betroffene können z. B. hören, dass etwas nicht stimmt – aber sie wissen nicht, was oder wie sehr.
Auch altersbedingte Hörverluste, besonders einseitige, können die Tonhöhenkontrolle massiv beeinträchtigen, ohne dass man es sofort merkt.
Hier wäre eine audiologische Abklärung sinnvoll, bevor gezielter Gesangsunterricht beginnt.
6. Psychologische Faktoren
Nicht zuletzt spielt die emotionale Verfassung eine Rolle.
Unsicherheit, Selbstzweifel oder frühere negative Erfahrungen („Du kannst nicht singen!“) können dazu führen, dass jemand seine Stimme innerlich „abschaltet“. Man traut sich nicht, singt zu leise, lauscht zu stark auf die Umgebung – und verliert dadurch die Selbstwahrnehmung.
Die Arbeit an der Stimme ist immer auch Arbeit an Vertrauen, Selbstbild und Präsenz.
Was kann man tun?
Wer sich in einem oder mehreren dieser Punkte wiedererkennt, muss nicht verzweifeln – denn Stimme ist entwickelbar. Aber: Der Weg ist individuell, erfordert gezielte Übungen und oft die Begleitung durch eine Lehrperson mit viel Erfahrung in Gehörtraining, Stimmbildung und körperbasierter Arbeit.
Hilfreich sind zum Beispiel:
- Singen mit Visualisierung (Stimm-Apps, Tuner, grafische Hilfen)
- Mentales Hören und innere Tonvorstellung
- Resonanzübungen mit geschlossenen Ohren / Knochenleitung
- Arbeit an Selbstwahrnehmung und Klangvertrauen
- Kleinschrittiges Arbeiten mit Intervallen statt ganzen Melodien
Mein Unterricht
Ich selbst begleite vor allem Menschen, die bereits musikalisch etwas mitbringen – sei es durch Chorerfahrung, Instrumentalspiel oder einfach ein gutes Gehör für Tonhöhen.
Meine Arbeit beginnt dort, wo es um Ausdruck, technische Entwicklung und künstlerische Gestaltung geht.
Wenn du gerade erst beginnst oder Schwierigkeiten hast, dich selbst beim Singen zu hören, empfehle ich dir, mit einem Coach zu arbeiten, die sich auf Grundlagenarbeit, Gehörtraining und stimmliche Orientierung spezialisiert hat.
Gern vermittle ich bei Bedarf einen passenden Kontakt.
Und natürlich können wir in einer Probestunde
herausfinden, wo Du stehst. Ich berate Dich gern, auch wenn kein nachhaltiger "Vertrag" dabei entsteht.